„Live in drei, zwei, eins!“
Imperative und Fragen der Theater_Digitälität im Bildungskontext
Tania Meier
Wenn auch die Stadt Ulm und das Land Baden-Württemberg die Austragungsorte waren, an und mit denen das 36. Schultheater der Länder vom LVTS und dem BVTS zusammen organisiert wurde, so war es doch vornehmlich die Internetseite des SDL21 sowie ein professionelles Studio in Blaustein, von dem aus das Gesamtevent auf die Festivalplattform im Netz und von dort aus auf die Bildschirme im Homeoffice der einzelnen Teilnehmenden abrufbar war. Ortlos also – unter Pandemie-Bedingungen in digitaler Übertragung.
Damit fügte sich das bereits zwei Jahre zuvor gewählte Motto Theater_Digitalität mit jenen Bedingungen, die bereits über eineinhalb Jahre nicht nur Schüler*innen und Lehrerende, sondern die ganze Gesellschaft vor die Computer, Tablets und Smartphones zwang, um zwischenmenschliche, private oder öffentliche Kommunikation herzustellen. Dieser lange Vorlauf im Einüben von Zoom, Skype, Webex hat die künstlerisch-ästhetische Produktion dessen, was wir Theater nennen, zumindest für dieses Festival gravierend verändert. Die Fragen der Ausschreibung wurden virulenter: Ob und wie sich das Verständnis von Theater verschiebt oder bereits verschoben hat, welche Effekte die alten und neuen medialen Tools auf unsere Arbeit haben, welche gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sie anstoßen. Und: Wie unter diesen Bedingungen was produziert wurde.
Meine ersten Eindrücke waren begleitet von Fragen wie: Was davon ist überhaupt noch Theater und was nicht (mehr)? Macht die Unterscheidung von Theater und Nicht-Theater noch Sinn? Oder haben wir es hier nicht doch mit ganz anderen Kunstformen zu tun (Film, Video, intermediale Performance) oder gar mit Debatten anderer Disziplinen wie der Medienwissenschaft oder Medienpädagogik, mit deren Vermittlungspraxen wir uns als Theaterschaffende in Bildungskontexten vielleicht noch zu wenig oder gar nicht beschäftigt haben: Kunstformen und Wissenschaften mit eigenen Historien, Profilen, künstlerischen Fragestellungen, aber auch fachwissenschaftlichen Perspektiven? Welche Impulse, die in diesen anderen Kunst- oder Mediensparten und deren Vermittlungspraxen vielleicht längst kritischer gesetzt und (künstlerisch) bearbeitet wurden, haben wir als Theaterleute möglicherweise noch zu selten gestellt? Und sind das jetzt unsere Fragen (geworden)?
Zumindest zwei Schultheater der Länder hatten sich bereits 2009 und 2017 mit Theater und neuen Medien bzw. mit Theater und Film auseinandergesetzt. In den Dokumentationen zu diesen Festivals finden sich Überlegungen, die für die Aktivitäten des aktuellen SDL und dessen Reflexion relevant sein könnten: Zur Unterscheidung von Theater und Film sowie zur anderen Funktionsweise von Film, Video, Medien in der Produktion und Rezeption als Theater; auch zum Verhältnis zwischen Akteur*innen auf der Bühne und dem Publikum (vgl: Leeker und Warstat im Fokus Schultheater 10/2011 sowie Gregor/Ernst, Pinkert und Lutz-Scheuerle im Fokus Schultheater 17/2018). In der aktuellen Situation stellten sich diese Fragen aber noch einmal neu, da es sich nicht nur um filmische oder mediale Inserts drehte, die im Präsenztheater integriert waren, sondern weil die Theaterproduktionen selbst und mit ihnen die gesamte öffentliche wie private Kommunikation zum allergrößten Teil unter dem Diktat des Digitalen stand und nur noch elektronisch über die Bildschirme an unterschiedlichen Endgeräten verlief bzw. verlaufen konnte. So kamen bei diesem Festival denn auch alle verfügbaren technischen digitalen Mittel (Apps, Plattformen, Programme) gleichzeitig zum Einsatz. Wenn damit zwar der Anschein einer gleichverteilten Zugänglichkeit geweckt wurde, so stellte sich doch neben der alles begleitenden Verbindungsproblematik auch eine Differenz im Zugang heraus, die sich durch Bedienungskompetenzen, v.a. aber auch aus unterschiedlichen Haltungen gegenüber Datenmissbrauch durch Großkonzerne ergab. Insbesondere bei Produktionen auf Instagram oder Facebook wurde dies relevant.
Auf neuen Bühnen
Neben den 14 Vorstellungen aus den Bundesländern waren fünf Gastspiele eingeladen, die sich durch besonders experimentelle Zugänge auszeichneten. Sie lassen sich folgendermaßen ordnen:
Neben zwei per Video aufgezeichneten Präsenzbeiträgen – eine Live-Performance zum Thema STOP ECOCIDE – STAR GOOD LIVING der afro-amazonischen Tänzerin Camyla Alves sowie einer Schultheaterproduktion aus St. Petersburg) – gab es zwei weitere, die in Direktübertragung gestreamt wurden: Die Gruppe der Weingartener Geschwister-Scholl-Schule spielte ihr Stück Roller im Roggen vor Ort im Studio; das Hamburger Gastspiel Eins_oder_Null – eine Faustadaption – wurde aus Hamburg live übertragen. Mit Caspar Weimanns Vorschlag (Weimann 2020) zur Unterscheidung von drei Arten von Bühne im digitalen Theater (physischer Raum, filmische Mittel, digitale Plattform) wären diese vier Vorstellungen als Events zu bezeichnen, die auf einer konkreten Bühne im physischen Raum hergestellt und mit einem Vor-Ort-Publikum sowie darüber hinaus im Netz mit einem weiteren Publikum geteilt wurden.
Bei den unterschiedlichen Beiträgen aus den Bereichen Video und Film (als Bühnen) ließe sich eine weitere Differenzierung vornehmen in
- solche mit narrativen Linien, zum Teil mit simuliertem Videokonferenz-Effekt;
- solche, die das experimentelle Spiel mit unterschiedlichen rhythmischen/zeitlichen und räumlich/bildnerischen Mitteln ins Zentrum rückten u.a. zur Herstellung verschiedener Wirklichkeitsebenen (Greenscreen, Animation); und schließlich
- solche, die als künstlerische Reflexionen von Erfahrungen des Lebens im digitalisierten Alltag verortet werden könnten.
Im Sinne Weimanns könnten als dritte Kategorie die Beiträge zusammengefasst werden, die die Interaktion mit dem Publikum auf dafür vorgesehenen Plattformen initiierten. Diese kamen dem Theater als Kunstform der Präsenz mit digitalen Mitteln am nächsten, da die interaktive Partizipation mit dem Publikum dabei in die jeweiligen digitalen Live-Vorstellungen integriert war. Hier schließt sich eine erste in der Theaterpädagogik noch nicht sehr oft gestellte Frage an: die nach dem Publikum, das sich im digitalen Raum noch einmal anders verortet als im analogen. Wo ist dieses Publikum eigentlich? Wer ist das Publikum, das da mit wem kommuniziert? Ist es noch ein Theater-Publikum? Und wie gestaltet sich Ko-Präsenz in welchen Räumen?
Ein anderes Publikum
Caspar Weimann stellt in einem Vortrag zu partizipativem Theater im Netz (Weimann 2020) die These auf, dass das Publikum im digitalen Theater anders konstituiert ist.
Wie funktioniert partizipatives Theater im Netz und was sind seine Tools?
Es kommuniziert und wird erkennbar, indem es kommentiert und mit anderen Zuschauenden interagiert. Kurzfristig baut es so eine Community auf. In bestimmten Fällen ist es auch partizipativ dabei, kommuniziert mit den Akteur*innen und nimmt so am Geschehen „auf der Bühne“ teil. Die Kommunikation verläuft parallel im Chat, durch Umfragen oder mit anderen Tools zum gemeinsamen Schreiben.
Zugleich ist jedes einzelne Mitglied dieses Publikums auch in der Lage, die Zuschaupraxis zu unterbrechen, ohne dazu die fortbestehende Interaktion auf der Bühne oder andere Zuschauende zu stören, da seine Nicht-Aktion, seine Orts- oder Praxiswechsel, seine Absenz nicht geteilt werden (müssen). Weimann beschreibt, dass dieses Publikum nicht unbedingt kontinuierlich am gleichen Ort ist, so dass sich eine andere Art der Ko-Präsenz einstellt, eine digitale Ko-Präsenz, die sich von der in der Theaterwissenschaft von Fischer-Lichte beschriebenen leiblichen Ko-Präsenz unterschiedet: Es ist partiell anwesend und abwesend, es nimmt teil, klinkt sich aus, hört zu, verschwindet für eine Zeit, kommt erneut vor den Bildschirm und wird wieder aktiv. Digitale Theater-Events finden somit in anderen Zeit-Räumen statt. Das Event streckt sich mitunter über eine längere Zeitspanne, in der sich die Zuschauer*innen einloggen und in Phasen dabei sein können, oder aber sich selbst mit ihren Endgeräten mobil an verschiedene Orte bewegen, so dass die Kontexte der konkreten Rezeption ständig wechseln können.
Auch aus der Zuschauenden-Perspektive lässt sich dies als eine andere Art der Präsenz des Publikums beschreiben, die sich in einer anderen Konzentration auf das Geschehen bemerkbar macht. Mich erinnert das an ein Zuschau-Verhalten in anderen historischen Zeiten: Auf den mittelalterlichen Marktplätzen oder den Bühnen des Shakespeare’schen Renaissance-Theaters war es selbstverständlich, dass sich das Publikum während der Vorstellungen interaktiv – auch untereinander – in Beziehung setzte. Es war normal, dass nebenher gesprochen, vielleicht gegessen und in die Luft geschaut wurde, wo vielleicht andere Dinge interessanter waren als das, was gerade auf der Bühne geschah.
Wolfgang Schivelbusch erklärt in seinem Buch „Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert“ (1986), wie die Erfindung des Bühnenlichts (durch Gas und Elektrik) maßgeblich dazu beitrug, das Publikum durch die Verdunkelung des Zuschauerraums in eine Stille zu versetzen und dazu zu nötigen, den Blick auf die beleuchtete Bühne zu richten und sich so auf das Geschehen zu konzentrieren. Das elektrische Licht fokussierte den Blick und erreichte schließlich das, was in der Erziehung des Publikums seit dem 18. Jahrhundert bis dahin trotz aller Bemühungen durch Handzettel mit Verhaltensregeln noch kaum gelungen war: still zuzuschauen.
Die fokussierte Ausrichtung der Zuschauenden auf die Guckkastenbühne ist verhältnismäßig jung und ist einem technologischen Innovationsschub im 19.Jahrhundert zu verdanken. Diese Zentrierung der Aufmerksamkeit wurde nicht zuletzt durch die (neuen) Mittel und Strategien des Theaters auch bald schon wieder unterbrochen, wenn auch auf eine andere Art, nämlich der gezielten Störung jenes zentralperspektivischen, monodirektionalen Blicks, der sich nicht zuletzt an der absolutistischen Position des Königs orientierte. Spätestens mit Piscator und Brecht wurde diese zentrierte Publikumshaltung gerade gestört, um ein Reflektieren über die eigene Haltung zum Bühnengeschehen zu ermöglichen. Diese Tradition ist durch Einsatz von Film erprobt und später auch in der Video- und/oder Performance-Kunst weitergeführt worden. Die aktuelle zeitgenössische Bühnenpraxis, v.a. die nicht-narrative, greift diese Tradition des intermedialen Spiels weiter auf und ermöglicht so die Befragung von (Blick-)Verhältnissen und von Öffentlichkeit bis hin zu politischer Interaktion im Kunstraum Theater. Auf diese Weise interagiert Theater (gestaltend) mit Gesellschaft.
Handelt es sich bei dem, was wir hier aus Ulm an Produktionen gesehen haben, auch um eine vergleichbare Fortführung eben jener kritischen Herstellung von Unterbrechungen, für die der mediale Einsatz genutzt wurde? Oder ist die Unterbrechung verschwunden angesichts der Faszination an technischer Professionalität oder am immersiven Spiel mit der App? Welcher Professionalitäten bedürfen die Theaterpädagogik und das Theater in der Schule in Bezug auf den Einsatz der (digitalen) Kamera und der Aufzeichnung, deren Zweidimensionalität und technischer Reproduzierbarkeit?
Neue Expertisen
Bei der nachträglichen Durchsicht der Produktionen in der Mediathek fiel mir auf, wie viele Teams sich professionelle Unterstützung im Großbereich Medien, Film, Kommunikationstechnik gesucht haben oder kooperativ mit anderen Fächern wie Medien und Kommunikation zusammengearbeitet haben. Das gesamte Festival als Event ‚in Ulm‘ steht gewissermaßen exemplarisch für diese Art professionalisierter Kooperation, wurde es doch faktisch im Studio der Maurer Veranstaltungstechnik GmbH in Blaustein bei Ulm und andernorts produziert. Der Bildungseffekt, der über die dort eingebrachte Expertise und Professionalität im Rahmen des Festivals erkennbar wurde oder sich an den Bildschirmen zu Hause zumindest erschließen lässt, ist – so meine These – zweigeteilt:
Für diejenigen, die im Homeoffice erwartungsvoll am Rechner saßen, mussten zunächst die zeitlich exakten Abläufe zutiefst beeindrucken, ebenso wie die technische Qualität der audio-visuellen Bilder und Übertragungen und nicht zuletzt die Gestaltung der Moderation vor Ort, die das ganze Event mit einer Nachrichten- oder Kultursendung im Fernsehen vergleichbar scheinen ließ. Auch die magic moments der greenscreen-Technik, deren Zaubereffekte mit Schall und Rauch vor der Eröffnung kurz zum Besten gegeben wurden, entfalteten volle Wirkung.
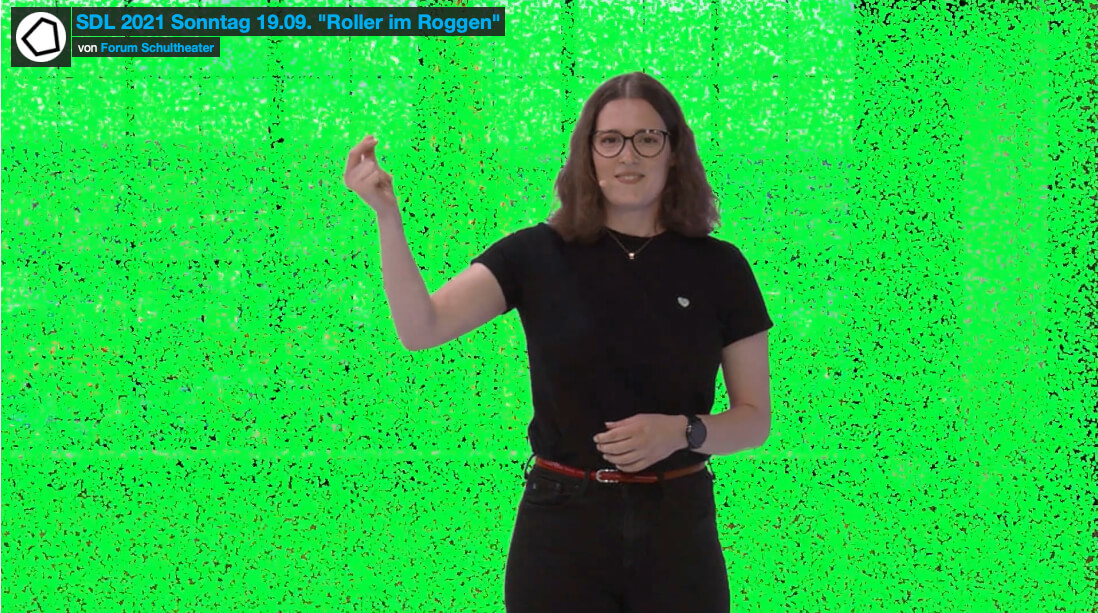
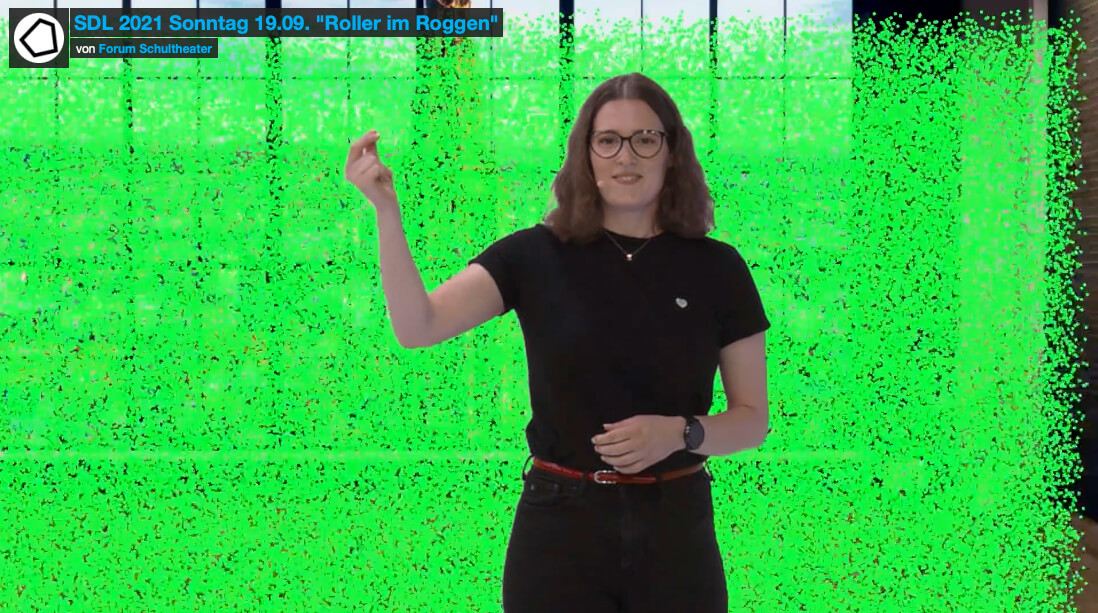
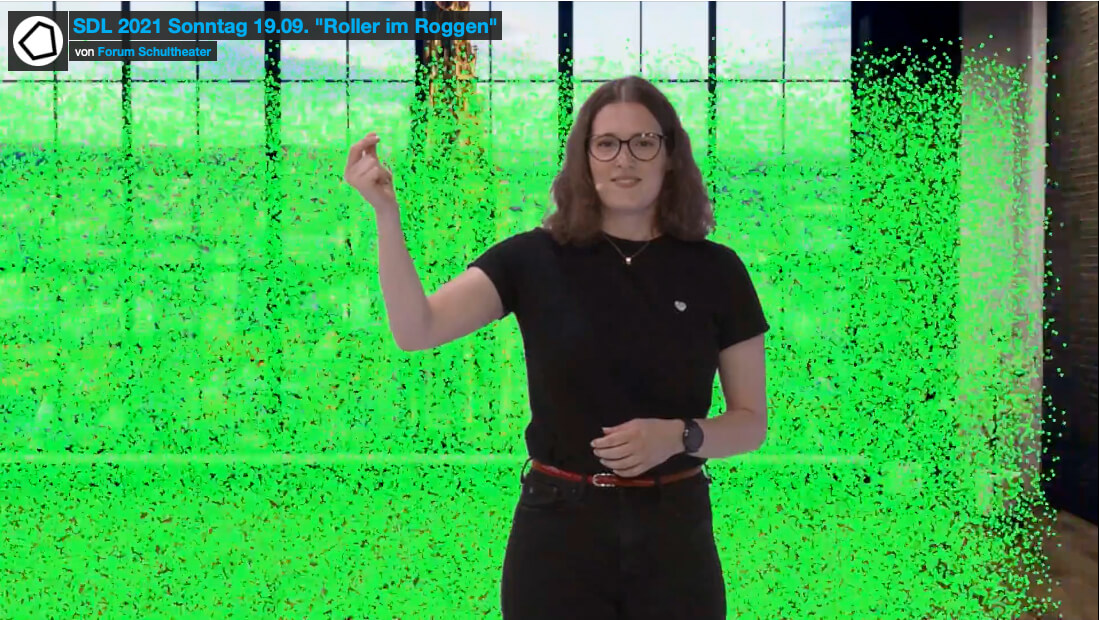


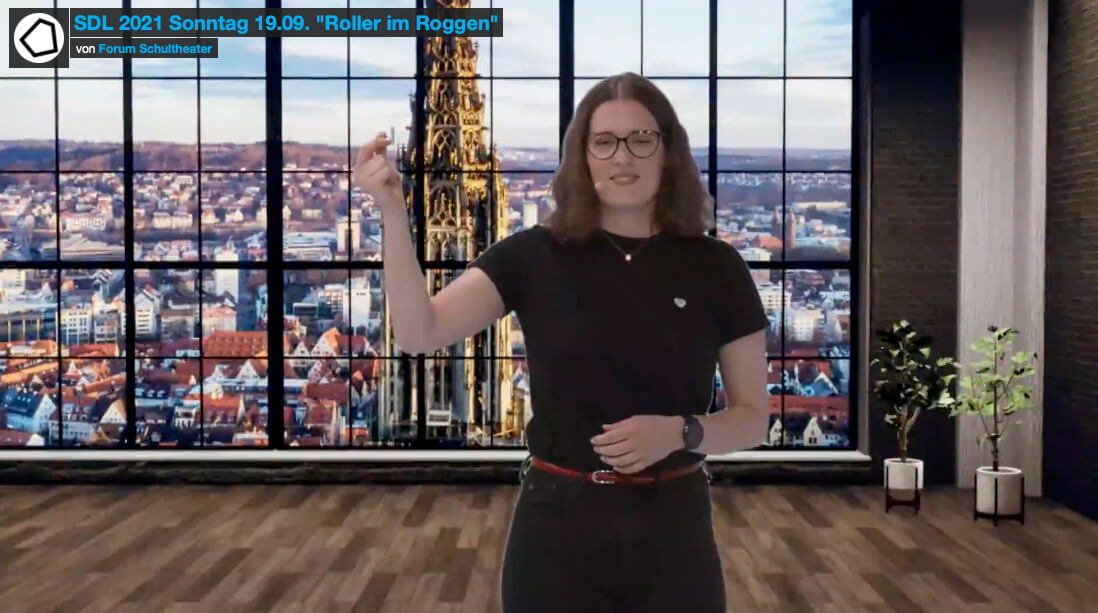






Greenscreen Magic
Das schien nicht nur hochprofessionell – es war professionell. Aber um welchen Preis? Die Frage stellt sich meines Erachtens auch angesichts der mantraartigen Wiederholung, dass Theater in der Schule zumindest professionelles Theater nicht nachahmen soll. Vor allem frage ich mich, welche Art der Disziplinierung durch welche Professionalisierung indirekt stattfindet und welche davon erwünscht ist.
Für die Zuschauenden zu Hause wurde der Anfang mit einem seriell vorproduzierten Vorspann gesetzt, der zunächst 15 Minuten lang zu beschwingter Stockmusik1Auch: Archivmusik, Produktionsmusik, Trailer Music: Musik, die vornehmlich für gewerbliche Zwecke komponiert wird, deren Nutzungsrechte über Lizenzen statt über GEMA-Gebühren erworben werden. Vgl.: https://de.audionetwork.com/content/musik-glossar/produktionsmusik Filmaufnahmen von Ulm aus der Vogelperspektive zeigte. Unter dem mittig platzierten SDL-Logo zählte eine digitale Zeitanzeige im Sekundentakt abwärts auf den Sendebeginn zu. Den eigentlichen Start signalisierte eine Bildmontage von sich senkenden Scheinwerfern, überblendet mit Bühnenauftritten von jungen Personen. Das zeigte sich im Kamera-Blick von der Backstage auf die Bühne so: Aus der Colt-Perspektive verfolgt die Kamera von hinten erst eine junge Frau (lange Haare, kurzer Rock), dann einen jungen Mann, wie sie im Gegenlicht an den Bühnenrand schreiten. Dazu eine Soundkulisse aus melodischem Trommelwirbel und tosendem Applaus. Schnitt auf eine Stockanimation: Ein sich öffnender violetter Vorhang gibt eine mit Scheinwerferlicht bespielte graue Bühne frei, in deren Mitte das schwebend einmontierte blaue SDL-Logo landet. Zum eingeblendeten Titel der Stücke und Bundesländer setzt eine männliche Stimme zum Start an: „Live in drei, zwei, eins!“
Vorspann
Dieses leitmotivisch funktionierende Intro, das nahezu jeder Anmoderation und jeder Stückeinspielung vorgeschaltet wurde, speist sich aus einem Bildrepertoire des Heldentums und des Starkults. Das wertet auf, macht Mut und taktet ein. Im Aufgreifen von vorhandenem Bildmaterial wird Bedeutung generiert, mit der Kontext hergestellt und Werte re-konstituiert werden. In den Silhouetten werden junge Menschen als medienaffin präsentiert, wie sie in einem bestimmten Gang geradeaus schreiten und von Applaus begleitet werden. Die Schemen werden zu Zeichen, die repräsentativ für Bühne, Erfolg, Jugend stehen und als Wertmaßstäbe ebenso mittransportiert werden wie die vorgestellten auratisierenden Ästhetiken. Zusammen ziehen sie einen stetigen Bildungseffekt mit sich, der bei einer medienpädagogisch vorgebildeten Zuschauerin sogleich Assoziationen zu dem aufruft, was einmal in den kritischen Medienwissenschaften als „Apparat“ oder „Logik“ bezeichnet wurde und der Machtreflexion bedurfte (vgl.: Hepp 2018: 5). Seit den 90er Jahren herrschte doch in der Medienpädagogik Konsens darüber, dass die Medienarbeit in der Schule zu einem kritischen Umgang mit Stereotypen befähigen sollte. Welche Professionalität ist also heute gefragt, wenn es um Theater_Digitaltität im Bildungskontext geht?
Anderes Wissen vor Ort
Dahingegen muss es für diejenigen, die als Akteur*innen des Festivals vor Ort waren, ganz andere Einblicke in die Produktionsmittel und ‑mechanismen gegeben haben. Erfahrungen, um die ich die Kolleginnen oder Mitschüler*innen am Set beneidet habe: Ein Studio mit einem Green-Screen, vor oder in dem die Moderator*innen gut geübt haben, um den geraden Blick in die Kamera zu halten (wie im Fernsehen); ganze Räume mit Bildschirmen und Schnittpulten und nicht zuletzt mit Kontroll-Monitoren ausgerüstet, auf denen das Ergebnis für die Akteur*innen am Set erkennbar wird.
Das Aufnahme- und Sendestudio
Selbstverständlich wird es auch ein eingespieltes Team für Kamera‑, Beleuchtungs‑, und Tontechnik gegeben haben, das freundlich, aber bestimmt den Ablauf im Griff behalten hat. Das Wissen, das sich allein mit dem Aufenthalt und der Arbeit in diesem Studio verbindet, unterscheidet die Bildungseffekte in Sachen Transparenz. In diesem Sinne hätte es sicher für alle Festivalteilnehmenden medienpädagogisch einen noch höheren Bildungswert gegeben, wäre dieses Wissen stärker und häufiger ins Zentrum gerückt worden. Denn die Fragen bleiben und werden konkreter: Wer ist offen und verdeckt an welchen Produktionsprozessen beteiligt? Wer steht hinter den Kameras, wer trifft am Schnittpult welche Entscheidungen zur Materialauswahl und ‑bearbeitung? Welche – mittlerweile leicht verfügbaren – filmtechnischen Mittel und Effekte kommen mitunter unbewusst zum Einsatz (Bildstabilisatoren, Farbausgleich, Autofokus…)? Und wie verändern diese den Blick auf Welt? Und wie das Verhältnis zwischen Produktion und Rezeption? Welche Professionalität wird an welcher Stelle wirksam? Und nicht zuletzt: Auf welche wollen wir uns in der theaterpädagogischen Praxis beziehen?
Was das Intro angeht, ist mir erst spät die Frage gekommen, wer diese Bilder, Animationen und Sounds wohl produziert haben könnte, bis mir klar wurde, dass Digitalisierung in der Praxis auch die Fortführung der Fragmentierung von Arbeitsabläufen mit sich zieht, die mit der Vermarktung von Stockmaterial im Internet einhergeht.
Professionalisierungen, aber welche?
Die Kamera führt den Blick. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Theater und Film, der in sehr vielen der vorgestellten Produktionen relevant, mitunter auch gezielt genutzt wurde. In Schön zum Beispiel, einer Site-Specific-Produktion aus Bremen, entwickelte die Gruppe Tanz-Choreografien im Stadtbild und kreierte dabei filmische Bildkompositionen, um Beziehungen zwischen Körpern und Architektur zu reflektieren.
Ausschnitt aus „Schön“, Oberschule am Leibnizplatz, Bremen
Das Spiel mit Effekten, Apps oder mit Schnittfolgen zeigte insgesamt eine Experimentierfreude, die sich durch alle möglichen Produktionen zog, sei es das Spiel mit Rhythmus – besonders in der Gastspielproduktion Appsolutely – oder das mit räumlichen Überblendungen (Intersections – Begegnungen aus Niedersachsen), auch die eine Videokonferenz simulierende Produktion aus Schleswig-Holstein Was wir dachten, was wir taten oder das Berliner Spiel mit Avataren, wenn die Spieler*innen durch den Blick in ein Schlupfloch auf einer Abenteuerinsel landen (Die Insel). Viele dieser Bewegt-Bild-Produktionen entstanden aus der (oder nutzen bewusst die) Nicht-Professionalität im Kameragebrauch, geschult nur durch den alltäglichen Umgang mit mobilen Endgeräten plus die (unbedarfte) Suche nach mehr. Das macht ihren Charme aus, fordert die medienbildenden Effekte im eigenen Filmdreh heraus und unterbricht somit auch die glatte, objektivierende, mitunter auch sexistische oder rassifizierende mediale Bildproduktion, die nicht zuletzt auch die social media Plattformen dominieren. Hier löste sich ein, was schon in den 80er/90er Jahren in der Medienpädagogik gepredigt wurde: „Um nicht nur den gerade zur Analyse genutzten professionellen Mustern verhaftet zu bleiben, sollte immer wieder […] nach alternativen Einstellungs‑, Perspektiv- und Montagemustern gesucht werden. Manchmal ergeben sich aus den Zwängen schulischer Amateurproduktion mit ihren technischen Unzulänglichkeiten gerade die Chancen, eingefahrene Seh- und Darstellungsmuster zu durchbrechen.“ (Eickmeyer 1992: 279)
Feministische Filmtheorie
Wie die Kamera einen objektifizierenden (zum Objekt machenden) Blick produzieren kann oder wie dieser ganz dezidiert unterbrochen werden kann, ist spätestens mit den Reflexionen aus der feministischen Filmtheorie thematisiert geworden. Als eine der bekanntesten Theoretikerinnen hat Laura Mulvey den Freudschen Begriff der Skopophilie dazu verwendet, um Begehrensproduktionen im Kino durch den männlich geführten Blick zu analysieren. Mulvey erklärt, wie visuelle Lust als voyeuristisches Potential im narrativen Kino über den „kombinierten Blick von Zuschauer und männlichen Protagonisten im Film“ hergestellt wird: „Der bestimmende männliche Blick projiziert seine Fantasie auf die weibliche Gestalt, die dementsprechend geformt wird. In der Frauen zugeschriebenen exhibitionistischen Rolle werden sie gleichzeitig angesehen und zur Schau gestellt, ihre Erscheinung ist auf starke visuelle und erotische Ausstrahlung zugeschnitten, man könnte sagen, sie konnotieren »Angesehen-werden-Wollen«.“ (Mulvey 1994: 55) Dabei hebt Mulvey als Unterschied zum Theater die zeitliche und räumliche Beweglichkeit in der Kameraführung (Ausschnitt, Perspektive, Bewegung…) und die Montage hervor, mit der im Film der andere Körper zum Objekt gemacht wird.
Auf diese andere Subjekt-Objekt-Beziehung im Theater, die in der theatralen, leiblichen Ko-Präsenz auch die Möglichkeit des Rück-Blicks vorsieht, hatte Christoph Lutz-Scheurle (2018: 46) mit Bezug auf Rolling Love beim SDL 2017 in Potsdam (Fokus: Theater und Film) verwiesen, einer Produktion der Weingartner Sophie-Scholl-Schule mit fünf stark eingeschränkten Akteur*innen. Dass diese Gruppe 2021 zur Eröffnung des Festivals ihr diesjähriges Stück Roller im Roggen im Studio vor Ort, d.h. in leiblicher Ko-Präsenz vorstellen konnte, war insofern wichtig; dennoch schlich sich in die Aufnahme der Vorstellung eine Tendenz zur Objektifizierung ein, die im Kamerablick, insbesondere in den (vielleicht notwendigen) Nahaufnahmen kaum verhindert werden konnte. Das ist zutiefst bedauerlich, zumindest jedoch der ebenso berechtigten Entscheidung geschuldet, die Vorstellung der Produktion auch unter Corona-Bedingungen nicht zu streichen.
Alte Muster der Objektifizierung
Eine andere Entscheidung hingegen, und vor allem deren Begründung, wirft im Wissen um den objektifizierenden und visuelle Lust erzeugenden Kamerablick Fragen auf, mit denen die Kriterien von Professionalität noch einmal genauer differenziert werden könnten. Bei der Brandenburger Film-Produktion raus bist #du, einer an Hollywood-Ästhetik orientierten Filmadaption des Theaterstücks Mädchen wie die, waren laut Jury-Begründung „die professionellen Schnitte und Kamerafahrten bzw. ‑einstellungen, die an aktuelle internationale Jugendserien erinnern“ ausschlaggebend für die Einladung. „Dadurch entsteht eine schnelllebige Erzählweise, die die Zuschauer*innen gefangen nimmt“ (SDL 2021: 13). Das mag sein. Aber welche Zuschauer*innen werden da wie „gefangen genommen“? Was genau wird mit welcher Professionalität und welchen filmischen Mitteln bedient?
Da triggert zum Beispiel eine Frage nach der Darstellung „von Nacktheit, ohne Nacktheit zu zeigen“, schon im Begleittext etwas an, was der Film mit einer ausgedehnten Badeszene am See untersetzt: Junge lachende Frauen räkeln sich bei strahlendem Sonnenschein auf der Wiese; streichelnde Gesten, spritzendes Wasser und viel Haut und Haar. Die abtastenden Nahaufnahmen rücken den Körpern der Darstellerinnen in gleicher Weise zu Leibe, wie bei Mulvey beschrieben. Fast verschluckt sich der Blick durch die Kamera an den erotisierten Topoi eines über Jahrhunderte angereicherten Bildarchivs, in denen Frauen von Männern beim Baden zugeschaut wird (angefangen vom Motiv der Susanna im Bade über das ganze Arsenal orientalistischer Haremsbilder und der expressionistischen Freiluftmalerei (u.a. Kirchner, Müller) bis hin zur Fotografie eines David Hamilton). Dieses Repertoire wird in der kritischen (feministischen) Kultur‑, Kunst- und Filmwissenschaft seit den 70er Jahren als visuelle Lust erzeugend und objektifizierend problematisiert (u.a. Berger, Schade/ Wenk), denn es perpetuiert eine Bildpolitik, die sich am männlichen Blick (male gaze) orientiert.
Die Expertise und Professionalität, die in dieser Produktion ein- oder „gefangen“-nimmt, könnte insofern durch einen kultur- oder auch medienwissenschaftlich geschulten Blick auf sexistische Bildproduktion und normative Schönheitsideale ergänzt werden.
Erfreulicherweise initiierte eine andere Produktion die intensive Auseinandersetzung mit genau diesen Fragen und bezog dabei zudem das Publikum in mehreren partizipativen Umfragen zu eigenen Erfahrungen eine (digitale Bühne): FeminisMuss aus Bayern war ein live-Event per Zoom, in dem zwölf Schülerinnen feministische Positionen erkundeten und diese mit eigenen Erfahrungen wie auch denen der Zuschauenden verknüpften. „Auf einer Skala von 1 – 10: Wie präsent ist das Thema sexuelle Belästigung in deinem Leben?“, wurde da z.B. auch gefragt. Standen am Anfang des Stücks noch Originalzitate von Parlamentsabgeordneten zur Debatte, die die Verwendung genderangepasster Anreden verweigerten, so entwickelte sich das Stück durch Reflexionen und Widersprüche hin zu einem offensiven Ende, bei dem ein virtueller Tanz aus Kampfposen jenen sexistischen Bildern und Werbeplakaten den Kampf ansagte, von denen wir ständig umzingelt sind. Das war ein Trost und hat die Hoffnung auf kritische Reflexion der Bildpolitik gestärkt.
Und nun zum Schluss: Gegen alle Vorannahmen hat es doch geklappt: Trotz aller Virtualität und Bildschirmstarrerei hat die Crew vor Ort es doch tatsächlich geschafft, aus digitalem Theater Theater zu machen, indem es das Festival ko-präsent und sogar zu einem Gemeinschaftsevent werden ließ. Das wurde (mir) in dem berührenden Moment des Abschieds gewahr. Es hat mich doch – gegen alle Logik – mitgenommen. Und vielleicht ist das – an der Stelle – auch einfach gut so.

Tania Meyer
Tania Meyer leitet seit Mai 2019 als Professorin die Abteilung für Darstellendes Spiel, Theater und Performance am Institut für Ästhetisch-Kulturelle Bildung der Europa Universität Flensburg; zuvor war sie an der Universität Potsdam als akademische Mitarbeiterin im Fach Kunstpädagogik/Ästhetische Bildung mit Schwerpunkt auf Performative Verfahren tätig; Theaterpädagogik am Theater, Projekte und Inszenierungen u.a. an der Württembergischen Landesbühne Esslingen, am Staatstheater Braunschweig, an der University of Delhi (Indien) sowie Projektpraxis als freie Theaterpädagogin in Kooperation mit Schulen, Theatern (GRIPS-Werke) sowie Institutionen der Aus- und Weiterbildung. Promotion im Kolleg Kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg mit einem Forschungsschwerpunkt auf Strategien rassismuskritischer Theaterarbeit.
Literatur
Berger, John. Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt. Frankfurt/M. 2018 [1972].
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen. Frankfurt/M. 2004.
Gregor, Alina/Ernst, Hanna Linn: Vortrag: „Anders die Sinne anregen. Filmische Mittel auf der Bühne in der Theaterarbeit mit Jugendlichen“. In: Fokus Schultheater 17. Zeitschrift für Theater und ästhetische Bildung. 2018, S. 12 – 18.
Eickmeyer, Rolf: „Schulische Medienerziehung in Projekten“. In: Wolfgang Schill u.a. (Hrsg.): Medienpädagogisches Handeln in der Schule. Opladen 1992, S. 273 – 294.
Hepp, Andreas: „Von der Mediatisierung zur tiefgreifenden Mediatisierung. Konstruktivistische Grundlagen und Weiterentwicklungen in der Mediatisierungsforschung“. In: Jo Reichertz / Richard Bettmann (Hrsg.): Kommunikation – Medien – Konstruktion. Braucht die Mediatisierungsforschung den Kommunikativen Konstruktivismus? Wiesbaden S. 27 – 45.
Leeker, Martina: „Intermediale Performances. Vom Umgang mit Medienkonvergenz 1966, 2001“. In: Fokus Schultheater 10. Zeitschrift für Theater und ästhetische Bildung. 2011, S. 8 – 19.
Lutz-Scheurle, Christoph: „Im Namen des Theaters! Im Namen des Films!“ In: Fokus Schultheater 17. Zeitschrift für Theater und ästhetische Bildung. 2018, S. 42 – 47.
Mulvey, Laura: „Visuelle Lust und narratives Kino“. In: Liliane Weissberg (Hrsg.): Weiblickeit als Maskerade. Frankfurt/M. 1994, S. 48 – 65.
Pinkert, Ute: „Vom Theater zum Film und zurück. Eine Vorrede und fünf Thesen zur szenischen Collage“. In: Fokus Schultheater 17. Zeitschrift für Theater und ästhetische Bildung. 2018, S. 28 – 33.
Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Studien zur visuellen Kultur. Einführung in ein transdisziplinäres Forschungsfeld. Bielefeld, 2011.
Schivelbusch, Wolfgang: Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert. München/Wien 1983.
Schultheater der Länder 2021, BVTS u.a. (Hrsg.): Programm. Ulm 2021.
Warstat, Matthias: „Schule der Bilder: Theater und neue Medien“. In: Fokus Schultheater 10. Zeitschrift für Theater und ästhetische Bildung. 2011, S. 1, S. 20 – 24.
Weimann, Caspar: #TT_Tutorials: „Wie funktioniert partizipatives Theater im Netz und was sind seien Tools?“. In: https://vimeo.com/422353485 [20. Jan.2022]